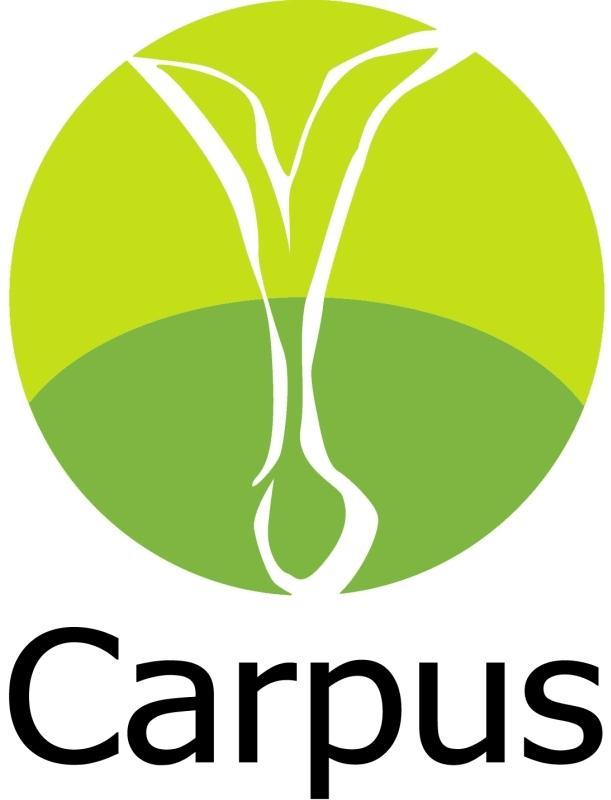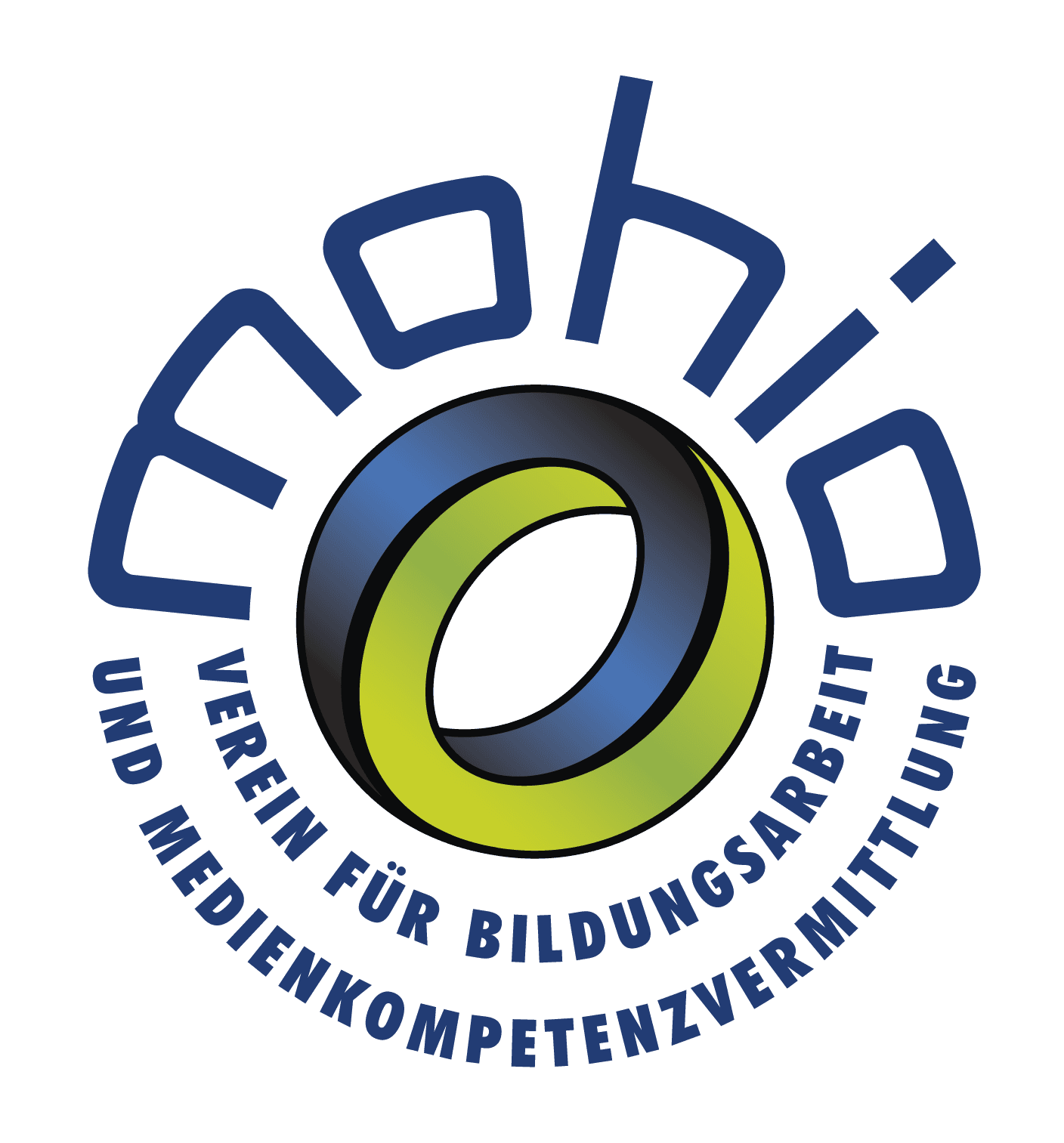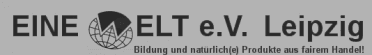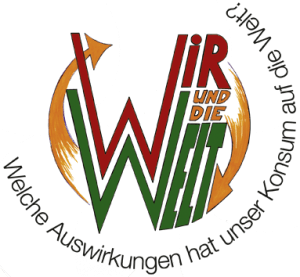Nicht Konsumentin, sondern Bürgerin
Mit „bewusstem“ oder „kritischem“ Konsum die Welt verbessern – geht das überhaupt? Ja, aber nur in engen Grenzen. Ohne andere globale, politische Rahmenbedingungen entfalten die besten Initiativen für mehr Nachhaltigkeit nur begrenzte Wirkung. Vor allem wenn es um die Einhaltung der Menschenrechte, soziale Mindeststandards für die Arbeiter*innen im globalen Süden und den Schutz der Umwelt geht. Das soeben beschlossene Lieferkettengesetz ist ein erster kleiner Erfolg, um diese Ziele zu erreichen. Weitere müssen folgen. Ein Artikel aus dem aktuellen Südlink 195 von Johannes Schorling
„Noch bevor du diesen Morgen dein Frühstück beendet hast, bist du auf die halbe Welt angewiesen“, lautet ein bekanntes Zitat des US-amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Das Zitat bringt auf den Punkt, wie vernetzt unsere globale Wirtschaft heutzutage ist: Im Smartphone, dessen Wecker zum Aufstehen klingelt, stecken allerlei Rohstoffe, die in Deutschland gar nicht vorhanden sind – zum Beispiel Kobalt, für das mit einiger Wahrscheinlichkeit Menschen im informellen Kleinbergbau in der DR Kongo unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen geschuftet haben.
Die Kleidung, die wir uns zum Frühstück anziehen, wurde wahrscheinlich von einer Näherin in Ländern wie Bangladesch oder Kambodscha zusammengenäht – weil die Löhne dort viel günstiger sind als hierzulande. Und die Hauptzutat für den Kakao auf dem Frühstückstisch kommt in den meisten Fällen aus Westafrika und wurde dort von Menschen geerntet, die deutlich unter dem Existenzminimum leben, weil der Weltmarktpreis für Kakao viel zu niedrig ist.
So kann es nicht weitergehen
ie wir konsumieren, hat also weitreichende Folgen für Menschen in anderen Teilen der Welt – auch wenn uns das manchmal gar nicht bewusst ist. Deshalb ist es begrüßenswert, wenn sich immer mehr Menschen Gedanken über die Auswirkungen des eigenen Konsums machen. Denn fest steht: So, wie „wir“ bisher konsumieren, kann es nicht weitergehen (dass dieses „wir“ zugleich problematisch ist, weil Konsum sozial sehr ungleich verteilt ist, wird im weiteren Verlauf noch Thema sein).
Der sogenannte „Erdüberlastungstag“ markiert jedes Jahr den Zeitpunkt, an dem die Menschheit so viele natürliche Ressourcen verbraucht und so viel CO2 ausgestoßen hat, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern beziehungsweise aufnehmen können. Er fiel im Jahr 2020 auf den 22. August. Betrachtet man nur die deutsche Bevölkerung, war der Erdüberlastungstag im vergangenen Jahr sogar schon am 3. Mai. Im Klartext: Wir verbrauchen in Deutschland etwa dreimal so viele Ressourcen, wie der Planet verträgt. Damit leben wir nicht nur auf Kosten zukünftiger Generationen, sondern auch auf Kosten ärmerer Länder im globalen Süden, die zum Beispiel von den Folgen des Klimawandels besonders stark betroffen sind.
Konsumkritik setzt bei unseren Entscheidungen als Verbraucher*innen an: Achten wir beim Kauf von Produkten nur auf den Preis? Oder spielt für uns auch eine Rolle, unter welchen Arbeitsbedingungen die Produkte hergestellt wurden und ob die Menschen, die daran beteiligt waren, einen fairen Lohn erhalten? Darf man heute noch Fleisch essen – auch wenn für Weideflächen und den Anbau von Futtermitteln im globalen Süden der Regenwald zerstört wird? Ist es vertretbar, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen – obwohl der Flugverkehr für fünf Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich ist?
Neben dem „was?“ geht es bei Konsumkritik aber immer auch um das „wie viel?“: Nutzen wir Produkte so lange, bis sie nicht mehr funktionieren – oder muss es jedes Jahr ein neues Smartphone sein? Versuchen wir, Dinge zu reparieren – oder schmeißen wir die Hose sofort weg, wenn sie ein Loch hat? Ist es wirklich nötig, dass jeder ein eigenes Auto besitzt, oder lässt sich ein Auto nicht auch teilen und so viel effizienter nutzen – wenn wir nicht gleich ganz auf Bus, Bahn und Rad umsteigen können?
Dass solche Fragen in den letzten Jahren immer mehr im gesellschaftlichen Mainstream ankommen, liegt nicht nur an der sich immer weiter zuspitzenden Klimakrise. Es ist auch ein Verdienst von sozialen Bewegungen wie etwa Fridays for Future.
Bewusster Konsum kann aus mehreren Gründen einen Beitrag zu einer zukunftsfähigeren Wirtschaftsweise leisten. Erstens können Ansätze des kritischen Konsums in der Praxis einen Unterschied machen. Ein Beispiel dafür ist der Faire Handel. Bei aller berechtigten Kritik – siehe dazu mehr weiter unten – zeigt der Faire Handel, dass gleichberechtigtere Handelsbeziehungen mit dem globalen Süden, als dies im konventionellen Handel derzeit der Fall ist, möglich sind. Kleinproduzent*innen erhalten durch feste Prämien und garantierte Mindestpreise ein höheres Einkommen, und Produzentenorganisationen haben in allen Entscheidungsgremien des Fairtrade-Systems 50 Prozent der Stimmen.
Das Fairhandelsunternehmen GEPA zahlt in der Kakao- und Schokoladenindustrie Preise, die hunderte von US-Dollar über dem liegen, was im konventionellen Handel gezahlt wird, und handelt diese nach dem Modell der partnerschaftlichen Preisfindung mit seinen Partner-Kooperativen aus. So sollen deren tatsächliche Produktionskosten und ein angemessener Gewinn berücksichtigt werden. War der Faire Handel lange Zeit ein Nischenphänomen, so ist er heute durch Fairtrade-Produkte im Discounter, Initiativen wie den Fairtrade-Town-Wettbewerb und Globales Lernen in den Schulen einer immer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Zweitens können Konsumentscheidungen im besten Fall eine Signalwirkung für Unternehmen und politische Entscheidungsträger*innen haben. Ein historisches Beispiel ist der Boykott-Aufruf von Greenpeace gegen den Shell-Konzern im Jahr 1995. Die Umweltorganisation protestierte damit gegen die geplante Versenkung der Ölplattform Brent Spar. Der Boykott-Aufruf fand ein breites Echo in den Medien und der Konzern knickte letztlich vor dem Protest ein. Wenige Jahre später konnte sogar ein generelles Versenkungsverbot für Ölplattformen erreicht werden.
Ein neueres Beispiel ist die „Flygskam“, zu Deutsch „Flugscham“, die in Schweden bereits ein geflügeltes Wort ist. Immer mehr Schwed*innen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie den Flieger nehmen. Die Zahl der Inlandsflüge ging in Schweden 2019 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent zurück – woran sicherlich auch die Klimabewegung und die Aktivistin Greta Thunberg ihren Anteil haben dürften.
Drittens können Ansätze kritischen Konsums auch Keimzellen einer anderen Gesellschaft sein, wenn sie sich kollektiv als Projekte einer solidarischen Ökonomie organisieren. In der Solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel wird schon jetzt mit Formen einer zukunftsfähigen Landwirtschaft experimentiert, bei der die Erzeugung regionaler Lebensmittel, der Erhalt der Biodiversität und die bedürfnisorientierte Produktion unabhängig von Marktmechanismen im Vordergrund stehen.
Solche Projekte sind immer auch ein Stück weit gelebte Utopie, eine Art „Laboratorium“ dafür, wie die Welt von morgen aussehen könnte. Appelle an Konsumbewusstsein können also nicht schaden. Und wer die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, sollte diese beim Einkauf auch beherzigen.
Entscheidend ist die politische Regulierung
Zum Problem wird es allerdings, wenn Menschen bei der Konsumkritik stehenbleiben. Immer wieder kann man bei Infoständen von INKOTA erleben, dass Besucher*innen sich nur dafür interessieren, welche Schokolade oder welche Kleidung sie denn „guten Gewissens“ kaufen können. Auch von politischer Seite werden die Konsument*innen gerne als zentrale Akteure des Wandels adressiert – zum Beispiel, wenn Entwicklungsminister Gerd Müller sich wünscht, dass „mehr Deutsche nachhaltig einkaufen“.
Häufig ist in diesem Zusammenhang von der „Macht der Konsument*innen“ die Rede. In ihrer extremen Form geht dieses Konzept davon aus, dass wir durch unsere Kaufentscheidungen bestimmen, welche Produkte Unternehmen auf dem Markt anbieten. Wenn Konsument*innen aufhörten, Produkte zu kaufen, für die Menschen ausgebeutet werden oder die Umwelt zerstört wird, würden Unternehmen diese auch nicht mehr herstellen. Ein solcher Ansatz misst den Konsument*innen eine weitaus größere Macht bei, als sie tatsächlich haben.
Ein Problem bei Konsumkritik ist nämlich, dass sie erst ganz am Ende der Wertschöpfung ansetzt. Die Sphäre der wirtschaftlichen Produktion bleibt außen vor – dabei gehören gerade die großen Industrie- und Energiekonzerne zu den größten Verursachern der Klimakrise. Allein 100 Unternehmen sind seit 1988 verantwortlich für über 70 Prozent der weltweiten industriellen CO2-Emissionen. Wenn Produkte, die aus ökologischer oder menschenrechtlicher Sicht bedenklich sind, erst gar nicht hergestellt werden dürften, würde der Konsum automatisch nachhaltiger. Statt Verbraucher*innen die Verantwortung zuzuschieben, wäre es also zielführender, die Wirtschaft so zu regulieren, dass Unternehmen von vornherein nicht zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung beitragen.
Ein Schritt auf dem Weg dorthin könnte das Lieferkettengesetz werden, auf das sich die Bundesregierung im Februar endlich geeinigt hat. Es soll Unternehmen stärker als bisher auf die Einhaltung der Menschenrechte in ihren globalen Lieferketten verpflichten. Allerdings bleibt das Gesetz deutlich hinter den Forderungen der Zivilgesellschaft zurück – denn es soll nur für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden gelten, für indirekte Zulieferer gilt nur eine abgestufte Sorgfaltspflicht, und eine zivilrechtliche Haftung für Unternehmen fehlt.

in weiteres Problem von Konsumkritik ist, dass die Forderung nach weniger Konsum in unserem derzeitigen kapitalistischen Wirtschaftssystem an enge Grenzen stößt. Dieses Wirtschaftssystem kann ohne Wachstum gar nicht funktionieren, hoher Konsum ist sogar erwünscht. Wenn wir alle gleichzeitig weniger konsumieren würden, wäre eine Wirtschaftskrise die Folge. Einen Hinweis darauf lieferte in der Vorweihnachtszeit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, als er das Einkaufen zur „patriotischen Aufgabe“ erklärte.
Die Idee von der „Macht der Konsument*innen“ überschätzt zudem den Einfluss, den wir als Verbraucher*innen tatsächlich auf Unternehmen haben. Souveräne Kaufentscheidungen zu treffen ist allein deshalb schon schwierig, weil den Verbraucher*innen dafür häufig die nötigen Informationen fehlen; globale Lieferketten sind häufig intransparent und die hinter den Produkten stehenden sozialen und ökologischen Probleme nicht ohne größeren Aufwand erkennbar.
Nachhaltigkeitssiegel mit begrenzter Aussagekraft
Um dieses Problem zu lösen und Verbraucher*innen Orientierung zu bieten, gibt es deshalb eine Reihe von Nachhaltigkeitssiegeln, die einen Konsum mit gutem Gewissen versprechen. Doch „nachhaltige“ Konsumalternativen halten häufig nicht, was sie versprechen. Die Begriffe „fair“ und „nachhaltig“ sind nicht staatlich geschützt, theoretisch kann jede*r diese für sich in Anspruch nehmen.
Unternehmen haben in den letzten Jahren Nachhaltigkeit als neuen Verkaufsschlager entdeckt. Und so findet sich heute auf immer mehr Schokoladenprodukten ein Siegel von UTZ oder Rainforest Alliance, die vor zwei Jahren zur größten Zertifizierungsorganisation im Kakaosektor fusionierten. Doch deren Nachhaltigkeitssiegel, das hat INKOTA in den letzten Jahren wiederholt kritisiert, werden ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. Denn von existenzsichernden Preisen für Kakaobäuerinnen und -bauern kann bei UTZ/Rainforest Alliance nicht die Rede sein. Bisher verfügt die Siegelinitiative nicht mal über garantierte Kakaomindestpreise.
Doch auch bei Fairtrade, das im Vergleich dazu eher als Vorzeigeinitiative gilt, kann von Fairness nur bedingt die Rede sein. Denn auch das Fairtrade-Siegel garantiert bisher keine existenzsichernden Preise, weshalb die Mehrheit der zertifizierten Bäuerinnen und Bauern nach wie vor unter der Armutsgrenze lebt.
Fair gehandelte Produkte gibt es zudem nicht für alle Bereiche. Im Fokus stehen im Fairen Handel Agrarprodukte wie Kaffee, Kakao oder Bananen. Im Bereich Elektronik steckt die Diskussion um nachhaltige Alternativen hingegen noch in den Kinderschuhen. Das liegt auch an der Komplexität der Lieferketten und der Vielzahl an Komponenten und Materialien, die zum Beispiel für ein Smartphone benötigt werden.
Auch der, wenn es um „nachhaltige Alternativen“ geht, gern bemühte Begriff „klimaneutral“ hält nicht immer, was er verspricht. Unternehmen oder auch Staaten betonen so ihren Beitrag zum Klimaschutz. Dabei bedeutet klimaneutral keineswegs, dass keine schädlichen CO2-Emissionen mehr ausgestoßen würden. Vielmehr werden entstehende Emissionen lediglich durch Ausgleichszahlungen für Klimaschutzmaßnahmen an anderer Stelle kompensiert.
Doch an der Wirksamkeit vieler solcher Ausgleichsmaßnahmen gibt es erhebliche Zweifel. Zudem werden nötige Klimaschutzmaßnahmen dadurch häufig in den globalen Süden verlagert, während hierzulande die Verschmutzung munter weitergeht. Die Klimaschutzexpertin Eva Rechsteiner kommt deshalb zu dem Fazit: „Klimaneutralität gibt es nur auf dem Papier.“
Kritischer Konsum, so ein weiterer Einwand, ist auch eine soziale Frage. Denn faire und nachhaltige Produkte kosten mehr Geld. Wer in Deutschland Hartz4 bezieht, kann es sich schlichtweg nicht leisten, im Biosupermarkt einzukaufen. Es wäre deshalb verfehlt, die Nase über „die Unterschicht“ zu rümpfen, der vermeintlich das Konsumbewusstsein fehlt und die zum Discounter rennt, weil es dort die günstigsten Produkte gibt.
Wenn alle Menschen die Möglichkeit haben sollen, bewusst zu konsumieren – dann müssen wir auch über höhere Löhne und Umverteilung sprechen. Tatsächlich sind es vor allem Menschen mit höherem Einkommen, die einen größeren ökologischen Fußabdruck haben, weil sie es sich leisten können, viel zu konsumieren und klimaschädliche Flugreisen zu unternehmen. Eine Oxfam-Studie kam 2015 zu dem Ergebnis, dass jemand aus dem reichsten Prozent der Weltbevölkerung 175 Mal so viele Emissionen verursacht wie jemand aus den ärmsten zehn Prozent.
Diese Einwände bedeuten nicht, dass es egal wäre, was wir konsumieren. Eine solche Haltung nach dem Motto „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen“ wäre angesichts einer immer weiter voranschreitenden Klimakatastrophe geradezu zynisch. Es bedeutet jedoch, dass bewusster Konsum bestenfalls eine Ergänzung sein kann zu politischer Veränderung. Vor allem müssen wir die politischen und wirtschaftlichen Spielregeln ändern, die es zurzeit ermöglichen, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden und der Planet zerstört wird.
Beim Einkauf auf Fairtrade-Produkte zu achten, ist also ein guter und wichtiger Schritt – aber damit Verbraucher*innen gar nicht erst vor die Wahl gestellt werden, ob sie Produkte kaufen, in denen Kinderarbeit steckt oder nicht, brauchen wir politische Lösungen wie etwa ein starkes Lieferkettengesetz. Auf das Flugzeug zu verzichten und stattdessen mit Bus und Bahn in den Urlaub fahren, ist ein guter und wichtiger Ansatz – aber damit das noch mehr Menschen tun, wäre es nötig, endlich alle Subventionen für den Flugverkehr abzuschaffen, eine hohe Kerosinsteuer zu erheben und massiv in den Ausbau des Bahnnetzes zu investieren. Damit das passiert, sind wir nicht nur als Verbraucher*innen gefragt – sondern vor allem als Bürger*innen.
Johannes Schorling Koordiniert die Kampagne Make Chocolate Fair! bei INKOTA und ist Teil des Steuerungskreises der Initiative Lieferkettengesetz.
Dieser Artikel ist im Südlink 195 "Kritischer Konsum: Was kann er erreichen – und was nicht?" erschienen.
- Den Südlink 195 "Kritischer Konsum" bestellen oder abbonieren